Der Tag, an dem die Gräfin PDS wählte
06.03.2016
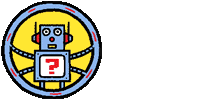
Wie alles anfing: ein Interview mit mir selbst – dem Gründungs-Redakteur der »ZEIT Online«
Aufgeschrieben habe ich dieses Selbstgespräch anlässlich des 20. Geburtstags der »ZEIT Online« am 6. März 2016. Ich habe diese Erzählform gewählt, weil ich glaube, dass sie eine unterhaltsame Mischung aus Anekdotischem und Selbstkritik erlaubt.
Sie finden hier die reine Textfassung meines Textes – die mit vielen Bildern und anderem Beiwerk versehene Multimediavariante finden Sie hingegen auf Atavist. Der Grund ist einfach: Dort gibt es eine Handvoll Werkzeuge, die ein lustvolles Zusammenfügen eines längeren Textes ermöglichen.
Ankowitsch: Anko, wenn Du …
Ankowitsch: … Sie, wenn es geht, Sie …
… gut, aber warum?
Weil es die Selbst-Distanzierung erleichtert.
Also, wenn Sie 20 Jahre zurückschauen: Wen sehen Sie da?
Einen Ankowitsch mit zweifelhaftem Haarschnitt, der bis spät nachts vor dem Computer sitzt, »Kruder & Dorfmeister« in Endlosschleife hört und mit fünf Ideen gleichzeitig für die Online-Ausgabe der ZEIT jongliert.
Wie kam überhaupt die Idee auf, dass es die ZEIT im Netz geben sollte?
Sie sagen es ja: Die Idee »kam auf« und machte sich in unseren Köpfen breit. Damit ist unter anderen Klemens Polatschek gemeint, mein Kollege, der die Computerseite der Print-ZEIT betreute. Frank Simon, der Ex-Präsident des CCC und unser Programmierer & Provider, war auch daran beteiligt, dass wir das für eine gute Idee hielten.
Gab es irgendwelche strategischen Überlegungen?
Wenn Sie den Willen, eine Website zu gründen wie andere Medien auch, als »strategische Überlegungen« verstehen – dann ja. Andernfalls lautet die Antwort: »nein«.
Jetzt bin ich aber gespannt, wie so eine Website aussieht. Zeigen Sie mal ein paar Screenshots.
Tut mir leid, es gibt keine.
Wie bitte?
Die Selfie-Kultur war damals noch nicht so entwickelt. Ich kann allerdings ein analoges Foto anbieten, das meine Mutter aufgenommen hat. Als sie mich besuchte, fotografierte sie den Bildschirm meines Rechners ab; ich fand das damals stark belächelnswert, heute muss ich Abbitte bei ihr leisten.
Schon mal was von archive.org gehört?
Auch dort werden Sie vergeblich nach der ZEIT suchen. Wir machten nämlich bei der »Bundesdatenautobahn«mit; so hiess ein Netzwerk lokaler Provider, das die Performance der Websites erhöhen sollte. Das hatte den Nebeneffekt, dass archive.org nur die virtuellen »Auffahrten«zur zeit.de gespeichert hat und die bestehen aus stets derselben blauen Seite im Mittelalter-HTML.
Wie sollen wir uns also die Startseite der zeit.de vorstellen?
Sechs Buttons, unten drei Links, null Fotos, Icons von Hendrik Dorgathen, ein paar ZEIT-Artikeln, Meldungen, Stellenanzeigen, wöchentliche Aktualisierung, das war’s.

Der analoge Screenshot der 1. Ausgabe der Zeit Online, den die Mutter des Autors mit ihrer Kamera aufgenommen hat. Damals ein Grund für höhnische Kommentare, heute ein Zeitdokument im doppelten Wortsinn
Spartanisch.
Wir hatten ja damals nichts. Als ich die Geschäftsführerin Hilde von Lang und Chefredakteur Robert Leicht zu überzeugen versuchte, dass wir unbedingt »ins Internet« müssten, stimmten sie nur unter der Bedingung zu, dass die ganze Sache nicht mehr als 20.000 DM kostet.
Was war mit dem »Internet-Literatur-Wettbewerb«, der kostete doch?
Stimmt. Wolfram Runkel, Reporter des ZEITMagazin, hatte einen guten Draht zu Hans-Dieter Huober, dem damaligen Pressesprecher von IBM. Er hat uns dann Geld dafür besorgt. Dieter E. Zimmer, Peter Glaser, Iris Radisch und Hermann Rotermund sassen in der Jury und wir haben die Teilnehmer ermahnt, keine Beiträge über 60 KB »einzusenden«, Links ins Netz waren in der 1. Runde verboten. Sie lächeln – und das zurecht.
Wie weit kamen Sie denn mit Ihren beschränkten Mitteln?
Erst mal bis zum »Spiegel«. Ich habe dort angerufen und mich bis zur Digital-Verantwortlichen durchgefragt. Sibylle Seidel hat mich dann stolz durch die Redaktion mit zwei Redakteuren und einem Compuserve-Moderator geführt und erklärt, wie man das macht.
Nicht sehr weitsichtig gedacht von der ZEIT.
Finden Sie das nicht ein wenig billig? Sitzen hier lässig und urteilen mit dem Wissen von 2016 über 1996? Damals spekulierten jedenfalls alle wild herum und keiner wußte nichts.
Sie behaupten also, dass man damals nicht erkennen konnte, wohin die Reise geht?
Auch wieder wahr: Ein paar Entwicklungen haben sich abgezeichnet. Und es gab Leute, die plausible Szenarien entwarfen, was auf die Verlage zukommen könnte. Das haben einige ernst genommen, aber die Radikalität der Umwälzungen haben sich viele nicht vorstellen können, mich eingeschlossen. Zum Beispiel die Sache mit den Rubrikenanzeigen: Schon nach zwei Tagen online hatten rund 1.200 Leute unseren Newsletter für die ZEIT-Stellenanzeigen abonniert; so habe ich das jedenfalls mit einem Bleistift in meinem »Filofax« notiert.
Das muss doch alle aufgeschreckt haben?
Jein. Die Verlagsleute (mich eingeschlossen) schwankten zwischen Staunen, Freude und Gleichgültigkeit. Ich kann mich noch sehr gut an eine Einladung nach Düsseldorf erinnern: Da sass ich vor ein paar Verlagsverantwortlichen und als ich anfing zu fragen, ob es nicht sinnvoll sein könnte, eigene Anzeigenmärkte aufzubauen, trübten sich die Pupillen meiner Gegenüber binnen Sekunden ein und ich wusste: Die Frage kommt nicht an. Ein faszinierender Effekt, den ich in diesen Jahren immer wieder beobachtet habe: trüb werdende Pupillen. Achten Sie mal drauf, wenn Sie anderen etwas Neues zu erzählen versuchen und sich nicht verständlich machen können.
Vielleicht lag’s an Ihnen?
Sicher sogar! Ich war ja Journalist, also dachte und handelte ich auch genau so. Ich hatte gelernt, dass die originellesten Ideen und die besten Texte gewinnen. Das führte dazu, dass wir ununterbrochen Neues produzierten; ich hatte aber nie gelernt, Projekte wirtschaftlich aufzusetzen, geschweigen denn erfolgreich zu machen. Aber der Zeitgeist hat diese lustvolle Produktion von Ideen auch stark gefördert. Hauptsache groß und verwegen.
Es ist wohl an der Zeit, die verlorene Unschuld des Netzes zu beklagen.
Das alles überstrahlende Bild in meinem Kopf – und nicht nur in meinem – war: Das Netz ist ein paradiesischer Kontinent! Bereit, von uns entdeckt und besiedelt zu werden, zum Nutzen aller. Man empfand sich als Angehöriger einer verschworenen Gruppe, die eine Art gigantische kommunistisch-urchristliche Hippiekommune mit Steckdosen schaffen wollte, erfüllt vom lieblichen Sound fiepsender Modems. Geldverdienen? Uninteressant! Neue Ideen? Je schillernder, desto besser! Den Rest würde das gute Karma des Netzes klären.
Geht es ein wenig konkreter?
Nehmen Sie das ZEIT-Diskussions-Forum. Es war naheliegend, dass ein meinungsstarkes Blatt wie die ZEIT genau das pflegen sollte: zivilisierte Debatten. Natürlich tauchten Querulanten auf – aber es waren so wenige, dass wir um das Herz jedes einzelnen kämpfen konnten; und oft gewannen wir. Die Anzahl der deutschsprachigen WWWler war aber auch so überschaubar, dass man sie zur Not in einem Frachter hätte außer Landes bringen können – wohin auch immer.
Benötigte man für solche Debatten tatsächlich das Netz?
Sie verstehen da was nicht. In diesen Foren zeigte sich in meinen Augen idealtypisch die zentrale Qualität des Netzes. Wie immer man auch argumentierte, welche Nöte man auch schilderte – immer fand sich jemand, der mit einem mitging. Die zentrale Botschaft lautete: »Du bist nicht allein!« Das ist bis heute eine zentrale Verheissung des Netzes geblieben. Für mich zumindest.
Das gilt aber nicht nur für Farbenblinde, sondern auch für Mörderbanden.
Sie sagen es. Ich dachte aber streng undialektisch und rein idealistisch. Sie können sich vorstellen, welche Enttäuschungsschübe diese Generation der Digerati durchzumachen hatte. Und zum Teil noch hat.
War es mit der Online-Begeisterung also schnell wieder vorbei?
Nein, die hat noch einige Zeit gehalten. So haben wir – mittlerweile waren Steffen Richter, Parvin Sadigh und Martin Virtel dazugekommen – einen Job-Roboter zusammengeschraubt. Das heisst, Martin Virtel hat geschraubt. Er kam als Praktikant, wollte Journalist werden, hat sich aber als Programmierer verraten und wurde von mir gezwungen, eine Job-Suchmaschine zu basteln. Die war ständig vom Zusammenbruch bedroht, weil sie aus kostenlosen Software-Modulen wie WebGlimpse zusammengeschraubt war. Aber die ganze Aufregung wurde wettgemacht durch den magischen Moment, als sie online ging. Es gibt nichts Schöneres, als auf Logfiles zu starren, die zeigen, wer gerade aus welcher Weltgegend dein Online-Angebot nutzt.
Ihr Hintergedanke bei der Suchmaschine?
Wir hatten keine Ressourcen, um ein vollwertiges journalistisches Angebot anzubieten. Also warfen wir uns auf die Entwicklung von Diensten, die zur ZEIT passten. So gab es Frido, unseren Newsdog; mit dem konnte man Newsletter verschiedener Anbieter abonnieren und verwalten. Eine Idee mit einem nicht ganz so idealistischen Hintergedanken: Wenn wir wussten, welche Newsletter wie häufig abonniert wurden, dann hatten wir das Ohr auf den News-Geleisen …
Eine andere schöne Sache war die Software, die einem sagte, wer man war. Erfunden hatte sie eine süddeutsche Uni, Name vergessen, und wir nannten das Angebot – kann nicht sein – auch vergessen. Egal. Die Idee kennt heute jeder: Man klickt die anonymisierten Statements politischer Parteien an und am Schluss sagt einem die Software, welcher Partei man wirklich nahestand. Das ganze hatte sogar den Segen der Gräfin.
Wie kam’s?
Als ich Gräfin Dönhoff einmal im Aufzug traf, fragte sie mich, was wir denn da im Internet so trieben. Ich lud sie ein, bei uns vorbeizuschauen. Als sie dann tatsächlich kam, klickte sie sich durch unseren Fragebogen. Das fand sie noch ganz lustig; dass sie hohe Übereinstimmungen mit der PDS aufwies, schon weniger.
Wir haben die Software dann aufgebohrt und allerlei Nonsense damit angestellt. Zum Beispiel den Test eingebaut, welchem Star-Trek-Charakter man am ehesten entsprach. Auf archive.org können Sie sich noch mal durchklicken.
Noch etwas fürs Protokoll, auf das Sie stolz sind?
Das Wichtigste habe ich noch nicht erwähnt: unsere »Wahl$treet«. Doofer Name, tolle Sache, nämlich eine Aktienbörse für Meinungsaktien. Die Idee stammte von der Uni Iowa. Gemeinsam mit Polatschek, der in der Zwischenzeit den Tagesspiegel Online verantwortete, und Frank Simon von ecce terram haben wir die erste Web-Version davon entwickelt. Die Grundidee: Menschen handeln an einer solchen Börse zum Beispiel die virtuellen Aktien von Parteien und bilden dadurch die aktuelle Stimmungslage ab. So lieferten wir vor der deutschen Bundestagswahl 1998 die zweitgenaueste Prognose – nach Allensbach.
Was mich originellerweise zur Frage bringt: Wie fand die ZEIT-Redaktion ihr Online-Baby denn so?
Es gab die idealtypische Verteilung von Befürwortern und Skeptikern. Eine stets wiederkehrende Frage lautete, ob es denn eine gute Idee sei, eigene Texte zu verschenken – in der Hoffnung, damit neue Leser zu gewinnen. Darüber wurde auch deshalb so grimmig gestritten, weil es Ende der 90er Jahre der ZEIT bei weitem nicht so gut ging wie heute.
Kein Rückblick ohne Hinweis auf vergeigte Chancen. Haben Sie welche zu bieten?
Viele. Wir haben es zum Beispiel zuwege gebracht, eine bereits geschlossene Vereinbarung mit Amazon nicht zu unterschreiben: Amazon hätte unsere Buch-Rezensionen bekommen, dafür unter jeder Rezension einen Abo-Link zur ZEIT gesetzt. Corinne Müller-Vivil, die damals bei Amazon arbeitete, war ein ZEIT-Fan und hatte nicht locker gelassen, bis es die Vereinbarung gab.
Starke Leistung!
Es kommt noch besser: Wir hatten eine unterschriebene Kooperation mit mobile.de, die auf Vermittlung unserer Programmiererin Barbara Thoens zustande gekommen war (sie kam übrigens auch vom CCC); den Vertrag abgeschlossen hatten wir mit Vijay Sapre. Die Kooperation war »ready to go« – und wir haben sie nie gestartet. Wir wollten die besten Oldtimer-Anzeigen abdrucken und zugleich einen eigenen Premium-Oldtimer-Markt für Print und Online aufbauen. Wenn ich jetzt genauer nachdenke, hat von unseren Ideen, die wir bis Ende 1999 entwickelt haben, keine einzige überlebt. Danke für diese Erkenntnis!
Woran lag’s, dass all die Dinge verschwanden?
An vielem. Zum einen an der oben beschriebenen Eigenart, dass ich Journalist und kein Manager war. Zum anderen an jenem Geschäftsführer, der nach meinem Wechsel zum ZEITLeben Ende 1999 endlich für ein professionelles Management sorgen sollte. Seine Leistung bestand allerdings darin, erst neue Büroräume anzumieten, alle unsere Entwicklungen einzustellen bzw. zu kippen und dann auf Nimmerwiedersehen abzutauchen. Der Job-Roboter verschwand zum Beispiel damals im Nichts, und die Kooperation mit mobile.de endete, bevor sie begonnen hatte – Vijay Sapre erzählte mir später, sie hätten die Champagner-Korken knallen lassen, als die Kündung des Kooperationsvertrags kam, weil sie bemerkt hatten, dass ZEIT Online davon ziemlich profitiert hätte. Lorenz Lorenz-Meyer wurde mein Nachfolger als Redaktionsleiter; er kann von der ganzen Angelegenheit ein langes, trauriges Lied singen. Schon alleine deshalb, weil er vorher Redakteur bei »Spiegel Online« war und heute als Professor für Online-Journalismus in Darmstadt lehrt.
So können wir keinesfalls aufhören!
Nicht? Wie wäre es mit jenem Wunsch, den ich immer ans Ende meiner damaligen Online-Kolumne namens »Briefe aus dem Bergwerk« setzte? Er lautete: »Energie!«
Was für eine großartige Zeit-Reise!